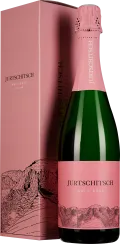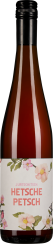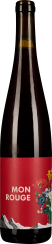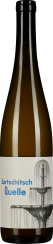Sortiment
Jurtschitsch
Seit 2009 leiten Alwin und seine Frau Stefanie das Weingut in Langenlois, das inzwischen zu den führenden Betrieben Österreich gehört. Ihr Ziel ist es, möglichst authentische, komplexe Weine mit kühl-eleganter Stilistik zu keltern und damit den erstklassigen Lagen maximalen Ausdruck zu verleihen. Dafür setzen die beiden auf biologischen Weinbau, gesunde Böden, minimale Eingriffe im Keller und Experimentierfreude.
Toplagen sind die Basis der außergewöhnlichen Weine: So etwa der Käferberg mit seinen kargen und steinigen Urgesteinsböden. Oder der Loiserberg, eine luftige, hohe Berglage, perfekt für Riesling und Veltliner. Die vielschichtigen, eher puristischen Weine werden von heimischen wie internationalen Fachmedien laufend prämiert.

Puristischer, präziser, eleganter
Stefanie und Alwin Jurtschitschs Weine wurden zuletzt noch puristischer, präziser und eleganter. Sie drängen sich nie auf, sind aber ungeheuer ausdrucksstark und spiegeln das Kamptal auf beste Art wider. Das beginnt bereits mit dem leichtfüßigen Grünen Veltliner „Im Klee“, dessen sympathischer Name auf die lebendigen Weingärten anspielt, in denen er wächst.
Schon als Alwin und Stefanie 2009 die gemeinsame Führung des Familienweinguts antraten, rückten sie die Biodiversität, das Bodenleben und den Humusaufbau in den Fokus. Erfolgreich wurde auf Bioweinbau umgestellt. So ist es nun möglich, die Eigenständigkeit und das Geschmacksprofil unterschiedlicher Rieden immer präziser herauszuarbeiten – großartig nachvollziehbar im feingliedrigen Grünen Veltliner von der kühlen Lage Loiserberg oder im tiefgründigen Riesling vom Heiligenstein.
Auch die hocheleganten Sekte vertreten die kühle Herkunft Langenlois und die gekonnt vinifizierte Naturweinlinie begeistert nicht nur Naturweinfans: „Belle Naturelle“ ist ein herrlich ungeschminkter Grüner Veltliner, den man unbedingt probiert haben sollte!
Alwin Jurtschitsch im Interview

Lieber Alwin, nicht nur eure Weißweine, auch eure Sekte zählen zu den besten des Landes. Wann, warum und wie habt ihr mit der Schaumweinherstellung begonnen?
Alwin Jurtschitsch: Das begann schon während unseres Studiums in Deutschland. Ein lokaler Weinhändler in Geisenheim war so smart, großzügige Rabatte für Studierende zu geben, auch auf Direktimporte von Bollinger – und zu feiern gab es immer etwas! So machten wir uns erste Gedanken, welche Weingärten, welcher Rebschnitt, welche Sorten sich im Kamptal für Sekt eigenen würden. Nach einigen Besuchen und dem Austausch mit Kollegen in der Champagne und nach viel flüssigem Recherchieren wurde 2007 aus der Idee Wirklichkeit, als ich zurück ins Kamptal kam. Ich kümmerte mich in den ersten Jahren nur um die Weingärten und hatte so genug Zeit, mich in das Thema der Weingartenbewirtschaftung für feine, elegante Schaumweine einzuarbeiten. Stefanies und meine Leidenschaft für Schaumwein ist nicht zu verheimlichen und das Kamptal mit seinem kühlen Klima und einzigartigen Böden bringt perfekte Voraussetzungen für einen Sekt-Stil, den wir selbst nicht nur gerne trinken, sondern auch machen wollten. Gesagt, getan. Zu Beginn wollten wir ganz klassisch Chardonnay und Pinot Noir verwenden, die unsere Eltern und Großeltern gepflanzt hatten. Die dafür ausgewählten Parzellen waren für uns jedoch „zu gut“, also zu warm für unseren Stil. Wir gingen nochmals auf die Suche nach den „kühlsten Parzellen“ im Kamptal und wurden in der Ortschaft Mittelberg fündig. Ein uralter Grüner-Veltliner-Weingarten mit Kordon-Erziehung war der Beginn für unseren Brut Nature 2007. In den hochgelegenen Hügeln rund um Langenlois schlummert ein Riesenpotenzial für Schaumweine.
Erzähl uns bitte etwas mehr zum Blanc de Blancs Brut. Welche Idee steckt hinter diesem ungeheuer trinkanimierenden Sekt?
Alwin Jurtschitsch: Der Blanc de Blancs ist der jüngste Zuwachs in unserer Sekt-Familie. An der Ostflanke der Ried Loiserberg wachsen Grüner Veltiner, Chardonnay und Weißburgunder nebeneinander auf Terrassen. Die kalkhaltige Lössauflage auf Glimmerschiefer hat es uns angetan und die Idee von Blanc de Blancs war geboren. Wir entwickelten ein spezielles System für unsere Sektweingärten, beginnend beim Rebschnitt. Wir versuchen einen etwas höheren Ertrag zu erzielen bei gleichzeitig niedriger Laubwand, um die Reife nicht zu früh zu provozieren und genügend Säure bei der Lese zu erhalten. Wir verwenden keine Trauben aus einer Vorlese. Jeder Sektweingarten wird speziell dafür ausgewählt und gepflegt. Wir wollen keine Sortensekte produzieren, sondern Sekte und Weine, die eine Geschichte ihres Bodens erzählen und die einzigartigen „Vibrations“ des Kamptals in die Flasche bringen. Der Blanc de Blancs Brut mit seinen vier Gramm Restzucker ist für uns eine super Visitenkarte des Kamptals. Für uns geht es um Finesse und Eleganz!
Gemeinsam mit Stefanie führst du ein Traditionsweingut mit langer Geschichte. Wie habt ihr zu eurem eigenen Weinstil gefunden?
Alwin Jurtschitsch: Natürlich respektieren wir die Traditionen und Geschichte des Weinguts. Tradition ist eine super Basis. Aber es ist auch die Aufgabe jeder jungen Generation alte Traditionen zu hinterfragen. Das Erfahrungswissen von Eltern und Großeltern ist ein unbezahlbarer Schatz, jedoch liegt es an uns, die Zukunft zu gestalten und Althergebrachtes für das Hier und Jetzt zu adaptieren. Sobald sich ein Parameter des Terroirs verändert, zum Beispiel das Klima, müssen wir uns an die neuen Vorgaben der Natur anpassen, um auch in Zukunft einen eleganten Kamptal-Stil in die Flasche zu bringen. Eine Tradition, mit der wir gebrochen haben, war die alte Sage von „je später der Weingarten geerntet wird, desto besser ist die Qualität“. Das war in den Siebzigern, Achtzigern der Fall. Das Klima hat sich verändert. Früher war es schwierig, gesunde reife Trauben zu ernten – heute ist in warmen Jahren die Gefahr der Überreife gegeben. Wir benötigen reife Trauben, keine überreifen. Für die Findungsphase unseres Weinstils sind wir um die Welt gereist, haben in Neuer und Alter Weinwelt gelernt und gearbeitet, aber immer mit der Frage im Hinterkopf: Was macht das Kamptal einzigartig? Und was können wir weglassen, um großen Wein im Kamptal zu erschaffen? Stefanie und ich haben glücklicherweise den gleichen Geschmack – sonst wäre das alles ein bisschen kompliziert.
Habt ihr in Bezug auf die Vinifikation einzelner Weine tatsächlich immer die gleichen Vorstellungen oder können die Meinungen auch mal auseinander gehen?
Alwin Jurtschitsch: Wir probieren und diskutieren viel miteinander, aber schauen dabei immer in die gleiche Richtung. Wir konnten gemeinsam viel Erfahrung sammeln, sei es bei gemeinsamen Ernten in Frankreich oder im Studium. Jeder neue Wein beginnt zu erst mal im Kopf, bevor wir uns langsam an die Umsetzung herantasten. Bei der Weinlese müssen Entscheidungen sowohl im Weingarten als auch im Keller schnell gehen, und da können wir uns zu 100 Prozent auf den anderen verlassen. Stefanie verkostet unsere Weine fast täglich im Weinkeller. Ich freue mich über gemeinsame Kellerrunden, bei denen wir die Fässer verkosten. Oft ist es so, dass sie mir am Abend ein paar Gläser zur Blindverkostung bringt und mich raten lässt. Dabei wird oft viel gelacht.
Terroir und Lagenunterschiede sind in euren Weinen hervorragend nachvollziehbar. Was charakterisiert den Riesling Ried Heiligenstein?
Alwin Jurtschitsch: Die Geologie macht den Heiligenstein so interessant. Verwitterten Wüstensandstein mit vulkanischen Einschlüssen aus der Permzeit, auf dem sogar noch Weinreben wachsen, findet man nicht so schnell. Die Urgewalten vor 250 Millionen Jahren haben es auch noch geschafft, diesen Fels um 90 Grad zu drehen, sodass man mit jedem Schritt den man am Heiligenstein von West nach Ost spaziert, in die Vergangenheit zurück gehen kann. Der Heiligenstein ist ein ganz großes Terroir, aber nicht einfach zu bewirtschaften. Er ist eine der wärmsten und trockensten Lagen des Kamptals. Schon nach oft nur 30 Zentimetern müssen sich die Rieslingwurzeln in den Spalten des Gesteins durchkämpfen. Für uns ist es ein Heiligenstein-Paradoxon, wie aus diesen Terrassen jedes Jahr die ausdrucksstärksten und mineralischsten Rieslinge entstehen können, aber das ist gut so.
Die Weinlese hat in Österreich 2024 so früh wie nie zuvor begonnen. Was sind dabei die größten Herausforderungen?
Alwin Jurtschitsch: Wir starteten am 21. August mit den Sektgrundweinen in unsere früheste Lese nach 2018. Am 10. September hatten wir fast die Hälfte unserer Lese bereits im Keller. Trotz des heißen Sommers hatten es die Wettergottheiten mit uns im Kamptal gut gemeint: Wir hatten ausreichend Niederschläge, sodass die Trauben in den letzten drei Wochen bei hohen Temperaturen und null Niederschlägen stressfrei reifen konnten. Bis jetzt alles gut und die Qualitäten sind atemberaubend. Wir starteten vor Sonnenaufgang bei noch kühlen Temperaturen und stoppten die Lese, sobald 30 Grad erreicht wurden. Wir lesen zum großen Teil in kleine Kisten mit Löchern, die wir in unseren „Cool Climate Room“ stellen können. Wir sind froh, dass wir dieses Jahr auf ein Kühlhaus zugreifen können, um die Trauben kalt zu verarbeiten. Hätten wir zu lange gewartet, wäre die Kamptaler Frische durch Überreife in Mitleidenschaft gezogen worden.
Impressionen
Weingut Jurtschitsch