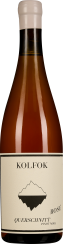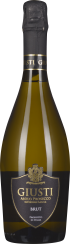Das süße Leben
Zucker im Wein: Tabuthema oder hedonistisches Spektakel?

Autor: Gerhard Scholz
Das Offensichtliche vorweg: Was für Wein gilt, gilt ebenso für Zucker und, wenn man dem alten Paracelsus glaubt, eigentlich auch für alles andere – auf die rechte Dosis kommt es an. Im Fall von Zucker ist jedenfalls sie es, die den Unterschied macht, ob ein Wein staub- oder knochentrocken, puristisch, präzise, konturscharf und geradlinig auf dem Gaumen aufschlägt oder denselben vollmundig, cremig, kraftvoll, rund und hedonistisch einhüllt.
Dabei liegt die Annahme, dass der Winzer irgendwo bei der Weinwerdung dem gärenden Wein ein Säckchen Zucker beimengt, gar nicht so fern. Nach seinem Erfinder, dem französischen Chemiker Jean-Antoine Chaptal, Chaptalisation genannt, ist es bis zu einer festgelegten Höchstmenge beim Weinmachen – im Gegensatz zum Motorsport – zwar erlaubt, Zucker in den Tank zu leeren, wird aber im Qualitätssektor immer seltener betrieben. Erstens erhöht man damit in der Regel nur den Alkoholgehalt des Weins und zweitens ist das Wissen darüber, wie man schon im Weingarten genug Zucker in der Traube entstehen lässt – zum Beispiel mittels Ertragsregulation, Laubarbeit, etc. – bei den Profis inzwischen hinlänglich verbreitet, und obendrein trägt natürlich auch der Klimawandel dazu bei, dass die Trauben ordentlich Zucker auf die Klosterneuburger Mostwaage bringen.

Probierpaket Restsüße
Vom knochentrockenen Wachauer Smaragd über das liebliche Duo Riesling Kabinett und Grüner Veltliner Liebling bis zur süßen Trockenbeerenauslese aus Sauvignon Blanc wird der Charakter dieser vier erstklassigen Weißweine jeweils von ihrem Süßegrad bestimmt.
Entdecken Sie die Balance zwischen Süße und Säure und die Bandbreite von puristisch bis hedonistisch; vergleichen Sie den Gaumendruck und die Struktur und entdecken Sie Ihre eigenen Vorlieben neu!
Anders ist es bei Schaumweinen, die nach der klassischen Champagnermethode vinifiziert werden. Ihnen wird in den allermeisten Fällen zweimal Zucker beigemengt: einmal bei der Tirage (in Form des Liqueur d’expédition), um die zweite Gärung anzukurbeln, und ein zweites Mal in Form der Dosage, um den Süßegrad des fertigen Produkts einzustellen. Nur gibt es da zwei fundamentale Unterschiede zum Stillwein: Zum einen versteckt sich der Zucker am Gaumen gekonnt hinter den feinen Bubbles und der höheren Säure, und zum anderen erwarten die meisten gerade beim Champagner Hedonismus, Fülle und Opulenz, und da kann ein bisschen Zucker Wunder wirken. Beim süßen Genuss und gemeinschaftlichen Feiern verzeiht man dann nur zu gern das eine oder andere Gramm im Glas.
Wer hier den gegenteiligen Weg der Totalabstinenz gehen möchte, sollte den alkohol- und zuckerfreien Blanc de Blancs von French Bloom probieren, der alles an Geschmack transportiert, was in eine einzige Kalorie pro Glas hineinpasst. Mit Selbstgeißelung hat das gar nichts zu tun – diese Bubbles stellen zweifellos die Schaumkrone dessen dar, was ohne Alkohol und Zucker möglich ist. Der unheimliche Aufwand, den die gesamte Getränkeindustrie betreibt, um den Geschmack von ein wenig vergorenem oder unvergorenem Traubenzucker nachzuahmen, spricht allerdings ebenso für sich.
Knochentrockene Empfehlungen
Besonders bei roten Stillweinen haben sich fortgeschrittene Weintrinker:innen jedenfalls angewöhnt, ihren Zucker am liebsten in vergorener Form zu genießen und deshalb zu trockenen Weinen zu greifen. Um sich keine Blöße zu geben, entscheiden sich auch Einsteiger:innen gern für die knochentrockene Variante und beschweren sich anschließend darüber, dass der Wein sauer schmeckt, loben aber im selben Atemzug andere Weine, die gerade noch so am oberen Limit von Trocken kratzen.
„Trocken“ bezeichnet nämlich nach dem österreichischen Weingesetz beim Stillwein eine Bandbreite von null bis maximal neun Gramm Restzucker. Bei der Liebe zum trockenen Wein kommt uns Österreicher:innen übrigens eine Sonderstellung zu: „Österreichisch trocken“ gilt bisweilen als umgangssprachliches Synonym für unter 4 Gramm Restzucker. Man könnte auch staubtrocken sagen, was sowohl zum Humor als auch zum bisweilen angestaubten Image der Alpenrepublik passt. Wagt man es dagegen über die Grenze hinüber in die andere Hälfte der ehemaligen Doppelmonarchie, findet man mitunter das Gegenteil vor: In Ungarn werden bei der Herstellung der Tokaji Essencia Zuckerwerte von 450 Gramm pro Liter und mehr erreicht. Manche Quellen berichten gar von Weinen mit 900 Gramm und mehr, wobei nicht nur die Berichte darüber, sondern auch die Essenzen selbst mit Vorsicht zu genießen sind. Meist werden sie nicht getrunken, sondern dienen dazu, die berühmten Süßweine der Region zu verfeinern.
Halbtrocken und lieblich
Trotzige Trauben
Wie alkoholisch und wie süß der Wein am Ende in die Flasche gelangt, liegt aber auch nicht immer in der Entscheidungsgewalt der Winzer:in, schließlich will nicht jede:r dem Wein im temperaturkontrollierten Edelstahlbehälter mit Reinzuchthefe seinen Willen aufzwängen. Bekennende handwerklich arbeitende Winzer:innen lassen der Natur gern mit natürlichen, weingutseigenen Hefen ihren Lauf, und liefern sich und das Ergebnis ihres Handwerks damit bis zu einem gewissen Grad der Kooperationsbereitschaft der Traube und ihrer Umgebung aus. Während die Technokrat:innen ganz einfach am Temperaturregler drehen und die dressierten Laborhefen ihr Werk verrichten lassen, müssen Low-Intervention-Anhänger:innen darauf vertrauen, dass der bockige Most von selbst wieder Fahrt aufnimmt – oder sich im schlimmsten Fall von ihrem Traum vom trockenen Wein verabschieden. Dass dabei exzellente Weine entstehen können, sieht man regelmäßig an großen Naturweinen wie Clos de la Coulée de Serrant, die im einen Jahr sec, im nächsten Jahr dann moelleux auf den Markt kommen. Große Weine sind eben gerade deshalb groß, weil sie nicht immer gleich schmecken, sondern die Signatur ihrer Herkunft und ihres Jahrgangs in sich tragen.

Besonders die Rieslingtraube zeigt sich bei der Gärung oft als Diva und stellt mit einem hochnäsigen „So kann ich nicht arbeiten“-Gestus ihr Werk einfach ein. So konnte man sie in jüngerer Vergangenheit beispielsweise im Keller von Bernhard Ott sehen, dessen hervorragender 2021er Riesling den Untertitel Kabin(O)tt bekam, weil das eine oder andere Gramm Restzucker partout nicht zu Alkohol werden wollte. Aktuell kostbar ist dieses Schauspiel an Gerhard Wohlmuths herrlichem Riesling mit dem kryptischen Namen Dr. Wu… K. Der Grund für diese Verstümmelung ist übrigens, dass der maximal zugelassene Restzucker für Riedenwein aus der Südsteiermark mit 4 Gramm pro Liter definiert ist, die der Wein, der sich am Vorbild des deutschen Riesling Kabinett orientiert, weit hinter sich lässt. Deshalb darf er nicht den ausgeschriebenen Namen seiner Herkunft tragen. Den ausgesparten Rest kann sich ohnehin jeder denken.
Wer also guten Wein trinken möchte, sollte sich nicht auf Zuckergrade versteifen, sondern erstklassigen Weinmacher:innen vertrauen. Diese erkennt man meist daran, dass sie, anstatt dem Wein ihren Willen aufzudrängen, das Beste aus dem machen, was die Natur ihnen in die Hand gibt. Entscheidend ist dabei weniger der Laborwert als die Balance zwischen Extrakt, Säure, Tannin und Alkohol. Irgendwie müssen Druck und Aromatik auch am Gaumen landen, und wenn der Wein nur von Säure oder nur von Tannin getragen ist, hat man irgendwann nicht mehr das Gefühl, Riesling und Zweigelt, sondern Zitronen und Barriques zu trinken. Außerdem können ausgeprägte Säure, Kohlensäure und Tannine den Zucker zwar nicht objektiv, aber subjektiv verschwinden lassen. Ein spannendes Beispiel ist Amarone: Der ikonische Sant’Urbano von Speri bewegt sich mit ungefähr 4 Gramm Restzucker im mittleren Bereich von Trocken und steuert noch enorme Fruchtsüße bei, bringt diese Werte aber mit prononciertem Tannin und hohem Alkohol in überraschende Balance. Ähnliches gilt für den südafrikanischen Cabernet Sauvignon La Dolce Vita aus der ArtiSons-Serie von Stellenrust, der nach der gleichen Methode hergestellt wurde: Während der zweiwöchigen Trocknung der Trauben auf Holzständern verlieren diese bis zu 40 Prozent ihres Gewichts. Der natürliche Wasserverlust treibt den prozentuellen Zuckeranteil entsprechend in die Höhe und lässt einen unheimlich intensiven Wein entstehen, dessen einzelne Komponenten trotzdem stimmig zusammenfinden müssen.
Süßwein
Unsere Empfehlungen
Prinzip Hoffnung
Wer keine Angst vor Süße hat und auf Qualität Wert legt, dem bleibt in der Welt der immer trockeneren Weine als letzter Ausweg noch immer der Süßwein. Leider ist die Kategorie längst nicht mehr so beliebt wie sie einmal war, aber ein paar unbeugsame Winzer:innen stellen immer noch unter größtem Aufwand und mit maximalem Risiko komplexe Eisweine und Trockenbeerenauslesen her. Zu den verschiedenen Verfahren, den Zucker in der Beere zu maximieren, gehört zum Beispiel jene, die Beeren am Stock hängenzulassen und darauf zu hoffen, dass eine kalte Nacht das Wasser in der Beere gefrieren lässt, schnell um drei Uhr nachts zu lesen und Zucker und Extrakt aus den natürlich gefrorenen Trauben zu pressen, in denen dann nur das Eis zurückbleibt. Oder darauf zu hoffen, dass sich in den Morgennebeln am Neusiedlersee oder im Sauternes-Gebiet in Bordeaux die edle Botrytis ansiedelt, die die Traubenhaut befällt und das Wasser in den Beeren verdunsten lässt, während weniger edle Pilze sich nobel zurückhalten. Dass all diese Weine eine unheimliche Aromenvielfalt aufweisen, ihre Süße oft herrlich mit ihrer Säure ausgleichen, fast ewig halten und mit Lobpreisungen von Kritiker:innen überschüttet werden, während sie oft zu Preisen verkauft werden, die den Aufwand niemals rechtfertigen würden, sorgt dennoch nicht dafür, dass die Nachfrage steigt – weil Zucker aktuell eben nicht im Trend liegt.
Dabei eröffnen gerade süße Weine eine vollkommen neue Welt der Speisenbegleitung. Natürlich kann man süß und süß miteinander kombinieren (mit Portwein und Schokokuchen macht man nicht viel falsch), aber noch viel spannender vermählt sich die Süße am Gaumen mit Fetthaltigem (Sauternes und Pastete), Intensivem (Blauschimmelkäse und Moscato d’Asti) oder besonders Scharfem. Letztlich bewahrt sich also auch hier die Devise, die beim Wein immer gilt: alles nur eine Frage der Balance …
Brut vs. Brut Nature
Art Brut
Wenn man nun den Blick auf das Weinetikett wirft, stehen da Wörter wie trocken, brut, lieblich, dry, sec, secco oder doux. Dass es dabei immer wieder zu Missverständnissen kommt, liegt in erster Linie daran, dass für Schaumwein, Stillwein und Süßwein im wahrsten Sinne des Wortes andere Gesetze gelten. Während Abweichungen nach der Herkunft dank umfassender EU-Verordnungen der Vergangenheit angehören, hängt die empfundene – und rechtliche – Trockenheit des Weins wie bereits angedeutet nach wie vor davon ab, ob er lustige Bubbles hat oder nicht. Beim Schaumwein wird nämlich mit 17–32 g/l als trocken bezeichnet, was beim Stillwein längst als lieblich gilt. Dafür geht die Skala nach unten weiter in einen Bereich, der im Deutschen „herb“, „extra herb“ und „naturherb“ umfasst. Aus Angst davor, Kund:innen mit derartigen Begriffen zu vergraulen, flüchten sich deutschsprachige Schaumwein-Winzer:innen in der Regel jedoch ins Französische und bezeichnen ihre Kreationen sexy als brut, extra brut und brut nature.

Aber auch die Franzosen kochen nur mit Zuckerwasser. So gründet die sagenhafte Wirtschaftspower der kühlen und regnerischen Champagne bis zu einem gewissen Süßegrad historisch auch nur darauf, dass die Winzer:innen ihrem sauren Wein Zucker hinzufügen, worauf dieser mit hübschen Bubbles reagiert – because science. Weil ebendieses Mousseux auch höhere Zuckerwerte tarnt, hat sich als Geschmacksstandard bei der abschließenden Zuckerbeigabe der Grad „brut“ etabliert. Der breitenwirksamste Champagner jedes großen Hauses, der den allermeisten Kund:innen schmecken soll, hat immer eine Dosage zwischen 0 und 12 Gramm Zucker pro Liter, Tendenz Richtung 12 versteht sich. Zum Vergleich: Bei extra trockenen Schaumweinen (extra dry) beträgt der Zuckergehalt 12–17 Gramm, bei trockenen (dry, secco, sec) 17–32 Gramm und bei halbtrockenen (demi sec) 32–50 Gramm pro Liter. Halbtrocken ist also weder feuchter als trocken, noch hat der Wein halb so viel Zucker – eher doppelt so viel. Dasselbe Resultat könnte man erreichen, indem man in einem Brut-Nature-Sekt 10 Stück Würfelzucker auflöst, wovon wir an dieser Stelle explizit abraten.
Brut Nature ist nämlich die Bezeichnung für Schaumweine mit 0–3 Gramm Restzucker – eine Wahl, die nur Winzer:innen treffen, die vollstes Vertrauen in ihren Wein haben und den individuellen Geschmack nicht verfälschen wollen. Deshalb trifft man auf diese Bezeichnung zumeist bei komplexen Großen Reserven mit jahrelangem Hefelager, die sich an Afficionados und Afficionadas mit viel Schaumweinerfahrung und feinen Geschmacksnerven richten. Als Partygesöff und Spritzwein entsprechend ungeeignet; für besondere Anlässe und kulinarische Höchstleistungen allerdings perfekt.
Pro…secco?
Sec, Secco, Prosecco
Das letzte Hindernis, das es in diesem Kontext zu beseitigen gilt, ist das Secco-Problem. Um sich vom anhaltenden internationalen Erfolgskuchen des norditalienischen Schaumweins ein Scheibchen abzuschneiden, haben zahlreiche findige Winzer:innen das Wörtchen „Secco“ erfunden und auf die Etiketten ihrer perlenden Weine geschrieben. Dabei geht es nicht um das italienische Wort für trocken – die meisten solchen Produkte tendieren zur Süße –, sondern darum, dass man einen Wein aus eigener Produktion zur Hand hat, wenn Gäste einen Prosecco verlangen. Das „Pro-“ am Wortanfang wird dabei in der Annahme, dass der Name der venezianischen Region als Synonym für „Wein mit Bläschen“ zu verstehen ist, geflissentlich überhört. Dahinter verbergen sich meistens günstige Schankweine, die künstlich mit Kohlensäure aufgepeppt wurden. Ganz anders verhält es sich bei echtem Prosecco, der zwar auch oft billig für den Supermarkt produziert wird, aber nicht nur im DOCG-Gebiet häufig in Handarbeit unter immer strengeren Auflagen hergestellt wird. Guter Prosecco gehört nach wie vor zu den Schaumweinen mit dem besten Preis-Leistungsverhältnis. Die Rebsorte, aus der die Weine hergestellt werden, hieß früher übrigens ebenfalls Prosecco, wurde aber in Glera umbenannt. Wenigstens dieses Missverständnis ist also inzwischen aus der Welt geschafft.
Stillwein
Trocken: bis 4g/l oder bis max. 9 g/l, wenn die Gesamtsäure nicht mehr als 2 g/l niedriger ist.
Halbtrocken: bis max. 18 g/l, wenn die Gesamtsäure nicht mehr als 10 g/l niedriger ist.
Lieblich: bis 45 g/l
Süß: über 45 g/l
Sekt
brut nature 0–3 g/l
extra brut 0–6 g/l
brut 0–12 g/l
extra trocken / extra dry / très sec 12–17 g/l
trocken / secco / dry / sec 17–32 g/l
halbtrocken / demi sec / medium dry 32–50 g/l
mild / doux / sweet / dolce > 50 g/l